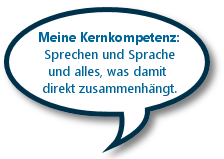Heiße Tage ohne Ölscheich - Juli 2008

Heiße Tage ohne Ölscheich
Auf Geschäftsreise in Saudi-Arabien
In Saudi-Arabien ist es ziemlich kühl jedenfalls solange man nicht das Haus verläßt. Fast bis zur Fröstelgrenze abgekühlt sind Restaurant, Hotelzimmer und Auto. Die Klimaanlage ist Standard. Wer sich aber nach zehn Uhr am Vormittag draußen aufhalten will, sollte ein hartgesottener Sonnenanbeter sein. Vierzig Grad im Schatten sind normal, nach Sonnenuntergang sind es immer noch mehr als dreißig.
Meine Geschäftsreise als Kommunikationstrainer führte mich zuerst in die Hafenstadt Jeddah, dann nach Riyadh ins Landesinnere. Ausländische Touristen gibt es nicht in diesem Musterland des Islam. Nur Business-Visa werden ausgestellt. Schade eigentlich.
Wer von meiner Saudi-Arabien-Reise hört, fragt garantiert nach den Ölscheichs, die ich treffen werde. Doch alle diese Frager muß ich enttäuschen: Selbst viele Saudis haben noch nie ein Ölfeld gesehen, geschweige denn täglichen Umgang mit den Schwerreichen, die Europas Gazetten mit erstaunlichen Geschichten füllen.
Alle Vorurteile über dieses Land lösen sich schnell in Luft auf, jedenfalls solange man selbst ein Reisender ist. Ich habe selten ein Land erlebt, wo ich mich so sicher fühlte. Daß vor vielen Hotels nicht nur Betonsperren stehen, sondern auch gepanzerte Militärfahrzeuge mit Maschinengewehren auf dem Dach, akzeptiere ich dankbar. Der Saudische König will klare Zeichen setzen, daß er auf der Seite der Guten steht.
Doch die Politik interessiert mich nicht wirklich. Das sei gut so, meint ein Saudischer Freund, denn von Politik und Mädels solle man in diesem Land die Finger lassen.

Nachdem 1938 Öl gefunden wurde, verwandelte sich der Beduinenstaat innerhalb weniger Jahrzehnte in ein modernes Land. Die traditionellen Lehmhäuser verschwanden. Die großen Städte wurden zu Metropolen, die sich mit ihrer modernen Architektur, der bestens ausgebauten Infrastruktur und allem modernem Standard nicht zu verstecken brauchen. Daß dabei manches erhaltenswerte Kulturgut verschwand, hat man inzwischen bemerkt. In Jeddah wie auch in Riyadh gibt es etliche Initiativen, traditionelle Bausubstanz zu erhalten oder wieder aufzubauen.
Ohne Auto ist man in diesen Städten hilflos. Gelegentlich sieht man einen Fahrradfahrer, Fußgänger gibt es fast gar nicht. Bürgersteige fehlen fast immer. Das Taxi zu benutzen ist dagegen einfach: Man stellt sich an den Straßenrand und streckt die Hand aus: Nach spätestens einer Minute kann man einsteigen. Die Fahrer können im Regelfall irgendwie auch Englisch und wissen meistens den Weg zum Ziel, das man ihnen angibt. Selbst Auto fahren zu wollen, sollte man vermeiden. Nicht nur, weil wir Deutsche den chaotisch anmutenden Verkehr kaum gesund überstehen würden, sondern auch, weil drastische Strafen drohen. Wer zu schnell fährt oder die rote Ampel ignoriert, zahlt nicht nur, sondern muß beim ersten Mal für einen Tag ins Gefängnis. Beim zweiten Mal wird der Besuch hinter Gittern verlängert.
Alle Gespräche in Saudi-Arabien beginnen mit der Frage, aus welchem Land man komme. Beim Stichwort Germany folgt reflexartig die Reihe Mercedes-BMW-Fußballweltmeisterschaft. Alles wird wohlwollend benickt. Das Gespräch ist eröffnet. Dienstleistungen werden fast ausschließlich von Nicht-Saudis erledigt: Inder, Pakistani, Sudanesen, Philippinos oder woher auch immer. Mehr als vier Millionen Ausländer leben hier friedlich neben 18 Millionen Saudis.
Das normale gesellschaftliche Leben beginnt frühestens um acht Uhr abends. Allerdings sollte man wissen, daß damit nicht Vergnügungen wie Kino, Theater, Konzert, Disko oder Sportverein gemeint sind. Alles das gibt es nicht in diesem islamischen Vorzeigeland. Einkaufen, Fernsehschauen und zensiertes Internet sind der Freizeitstandard. Wer eine Familie hat, widmet sich dieser. Kinder werden geliebt, besonders die Mädchen. Sie bringen bei der Verheiratung gutes Geld, das der Bräutigam zahlen muß jedenfalls solange die Erwählte jungfräulich in die Ehe geht. Ansonsten wird sie zurückgegeben.
Beim Thema Frauen werden die Saudis komisch. Für Frauen ist in der Öffentlichkeit der schwarze Umhang, die Abaya, zwingend vorgeschrieben, dazu das Kopftuch. Oft sieht man vom Gesicht aber nur die Augen, manchmal sind auch diese hinter Schwarz verborgen. Als Single-Mann sollte man Frauen meiden: nicht auf die gleiche Bank setzen, nicht allein mit ihnen im Fahrstuhl fahren, nicht die Hand geben, nicht hinterherschauen, am besten ignorieren. Sie zu fotografieren ist total verboten. Kinder werden vom frühen Alter an nach dem Geschlecht getrennt. Schule, College oder Universität unterrichten selbstverständlich nicht gemeinsam Jungs und Mädchen. Dadurch würde die Ablenkung verhindert und man könne besser lernen, erklärt man mir mehrmals.
Wer hinter diese offizielle Erklärungsfassade schaut, entdeckt viele unausgelebte Sehnsüchte. Wo immer ein junger Mann einem Mädchen nahekommt, denkt er an na ja, sagen wir mal ans Heiraten. Der ungezwungene Umgang mit dem anderen Geschlecht, den wir in Europa pflegen, fehlt komplett. Mir wurde schon nach zehn frauenlosen Tagen komisch.

Doch keine Regelung ohne Spielräume. Wer die schwarze Tracht der Frauen genauer anschaut, entdeckt eine ungeheure Vielfalt. Da werden schwarze Applikationen in unterschiedlichen Schwarztönen aufgenäht, Raue, glatte oder glänzende Stoffe wechseln sich kunstvoll ab. Saum und Ärmel enthalten zarte Bordüren. An den netten Füßchen kann man feinste Sandalen entdecken, die von der Farbenpracht künden, die sich unter der Abaya verbirgt. Was die schicken Handtaschen kosten, kann ich nur ahnen, wenn ich mir die modischen Geschäfte in den großen Einkaufszentren anschaue.

Jeddah war schon immer weltoffener als Riyadh. Als Ankunftsstadt für die zwei Millionen Pilger im Jahr ist man hier internationales Publikum gewöhnt. Das zeigt sich bis hin ins Freizeitverhalten. Wer abends an der viele Kilometer langen Uferpromenade, der Corniche, spazierengeht, ist umgeben von ausgelassenen Menschen. Grell beleuchtete Kutschen stehen für Fahrten zur Verfügung. Jugendliche brausen mit unbeleuchteten Quads herum, reiten wild auf kleinen Pferden oder ruhig auf Kamelen. Selbst kleinste Kinder spielen dort bis weit nach Mitternacht. Einmal habe ich ein Paar gesehen, daß sich in der Öffentlichkeit umarmte eine geradezu revolutionäre Freizügigkeit. Die seien wohl frisch verheiratet, kommentierten meine saudischen Freunde.
In Riyadh ist das Leben viel stärker geordnet. Man spürt die Würde der Hauptstadt. Zwar sieht man auch hier auf den Plätzen tobende Kinder, die begeistert Fußball spielen und stolz ihr T-Shirt mit der Aufschrift Klose tragen. Aber sobald der Muezzin zum Gebet ruft immerhin fünfmal am Tag , schließen alle Geschäfte und die kleinen Imbißstuben. Für fünfzehn Minuten zieht sich das Leben in die Moscheen zurück. Was einem Europäer befremdlich anmutet, hat für die Muslime einen erlebbaren Sinn: Vor dem Gebet stehen die Menschen beieinander, plaudern und pflegen Kontakte. Im Gebet wird dieses Gemeinschaftsgefühl noch einmal intensiviert. Soziale Verbundenheit und damit viel Sicherheitsgefühl ist die Folge. Träumen wir in Deutschland nicht auch manchmal von solch einer sozialen und spirituellen Gemeinschaft?

Im Altstadtviertel von Riyadh, Al Dira, treffe ich meinen Freund Zia. Er betreibt in einem der vielen Souks einen kleinen Laden, in dem Futterale für Pistolen und Gewehre verkauft werden. Die Saudis sind nämlich leidenschaftliche Jäger. Zia habe ich wie durch Zufall kennengelernt. Ich schaute seine Waren an, dann folgte ein Gespräch. Bald tranken wir süßen Milchtee, und ich lernte seine Freunde kennen. Inzwischen weiß ich viel über seine Familie, die in Pakistan lebt, und seinen Alltag als Händler. Seine Einladung zum pakistanischen Essen mußte ich leider aus Zeitgründen absagen. Wenn ich wieder in Riyadh bin, werde ich ihn besuchen. Er wird mich freudig begrüßen.
Ich habe in Saudi-Arabien viele liebenswerte Menschen getroffen. Einige schenkten mir die Gelegenheit, ein wenig an ihrem Alltag teilzunehmen. Die Saudische Hochzeitsfeier war ganz anders, als es dieses Fest in Deutschland ist. Ab zehn Uhr abends treffen sich sehr viele Freunde, die Familie und auch entferntere Bekannte. Natürlich sind Männer und Frauen streng voneinander getrennt. Erst sitzt man beisammen, plaudert und trinkt Tee. Um ein Uhr nachts gibt es das traditionelle Lammfleisch mit Reis, danach brechen die Männer auf. Die Frauen dagegen feiern weiter, machen Musik, tanzen und essen ausführlich. Die Abaya haben sie abgelegt, denn Männer dürfen all das nicht sehen. Im vertraulichen Gespräch wurde mir erzählt, wie prachtvoll und farbenfroh die Kleider seien, die dort getragen werden. Auch sei die Haut der Saudischen Frauen weich und sehr gepflegt. Ich weiß davon nichts, denn ich sehe immer nur schwarze Gestalten. Erst im Morgengrauen lassen sich die Frauen von ihren Ehepartnern oder Brüdern abholen. Daß dabei Alkohol für alle tabu ist wie in ganz Saudi-Arabien, sei nur erwähnt. Seine Abwesenheit schmälert nicht die Munterkeit des Umgangs miteinander.
Das emotionale Zentrum der Gemeinschaft in Saudi-Arabien ist die Familie. Die Beziehungen untereinander werden intensiv gepflegt. Zugleich bietet die Familie abschirmenden Schutz nach außen. Die Verkehrung dieses Zusammenhalts ist dann das, was man Habibi-Business nennt: Wer Einfluß auf eine Stellenbesetzung in einem Unternehmen hat, wird die Verwandten bevorzugen, auch wenn sie sachlich in keiner Weise geeignet sind, die beruflichen Anforderungen auszufüllen. Das führt häufig zu gravierenden Problemen in Unternehmen. Doch Änderung ist unwahrscheinlich, solange aus unserer Sicht traditionelle Gemeinschaftsstrukturen vorherrschen.
Nach zehn Tagen lasse ich manche Freunde zurück. Vielleicht gelingt es, den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Würde ich gerne in Saudi-Arabien leben? Ich glaube nicht. Als Reisender habe ich die Freundlichkeit, die Wärme und manche Heiterkeit genossen. Als ein Bewohner wäre ich in Gewohnheiten gezwungen, die meinen mitteleuropäischen Freiheitsdrang zu stark einschränken würden. In meinem Herzen aber keimt eine kleine Sehnsucht, im nächsten Jahr wieder nach Saudi-Arabien reisen zu können: dann zum vierten Mal. Bernd Seydel
Veröffentlicht im TOP-Magazin Thüringen, Herbst 2008
Kleiner Nachtrag: Die Sehnsucht wurde gestillt. 2010 reise ich für Seminare zum sechsten Mal nach Saudi-Arabien.